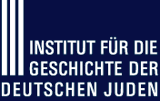Die Hamburger Gesellschaft für jüdische Volkskunde wurde 1898 aus der Henry Jones-Loge heraus und mit Rabbiner Max Grunwald als treibender Kraft gegründet. Ihr Ziel war das Sammeln, wissenschaftliche Erforschen und Ausstellen zeitgenössischer jüdischer Kultur und historischen Kulturgutes. Ihre Geschichte ist zwischen 1913 und 1937 mit der des früheren Hamburger Museums für Völkerkunde, heute Museum am Rothenbaum (MARKK) verknüpft. In dieser Zeit war die Objektsammlung dort als Leihgabe verwahrt und ausgestellt. Nach ihrer Entfernung aus der Ausstellung 1935, wurde sie 1937 vom Museum an den letzten Vorsitzenden der Gesellschaft, Rabbiner Simon Simcha Bamberger, übergeben, der sie vermutlich in Hamburg bis zu seiner Emigration 1939 verwahrte und zu retten versuchte. Danach verlieren sich die Spuren der Sammlung.
Im MARKK befinden sich heute wieder neun der ursprünglich 440 Objekte, die im Rahmen der Provenienzforschung zu NS-Raubgut am Museum untersucht werden. Sie sind der Anlass für diese gemeinsam von IGdJ und MARKK konzipierte Online-Ausstellung. Die Ausstellung versucht zwei Perspektiven zu vereinen: Sie nimmt in den ersten Kapiteln vor allem eine historische Einordnung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde und ihrer Sammlungstätigkeit vor und folgt dabei zunächst einem chronologischen Narrativ, bevor das fünfte Kapitel aus einer dezidiert provenienzgeschichtlichen Perspektive das Objekt als Ausgangspunkt nimmt und so in den Vordergrund rückt. Das abschließende sechste Kapitel weist auf die heutige Relevanz und Aktualität der Auseinandersetzung mit diesen Geschichten und Objekten im Museum und in der Forschung hin. Weiterlesen...
Der Zugang ist dabei dabei objekt- und quellenorientiert, was dadurch unterstrichen wird, dass sich im Anschluss an dieses Intro ein interaktives Quellendokument und zu Beginn eines jeden Kapitels Miniaturansichten verwendeter Quellen als interaktive Einstiegsmöglichkeiten finden, um direkt zu den entsprechenden Inhalten zu navigieren.
Thematisch relevante Aspekte sind das Aufkommen der jüdischen Volkskunde um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert als Ausdruck einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Tradition und Gebräuchen, aber auch einer Selbstvergewisserung und eines Nachdenkens über jüdische Identitäten angesichts einer zunehmenden Säkularisierung und den sich gleichzeitig immer deutlicher zeigenden Grenzen der Akkulturation durch den aufkommenden politischen Antisemitismus. Die Gründung der Gesellschaft verweist auf das wissenschaftliche wie gesellschaftliche Engagement innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in einem bürgerlichen Milieu, in der einige herausragende Persönlichkeiten besonders prägend für das Vereins- und Kulturleben waren. Sie macht zugleich deutlich, wie sehr Tätigkeiten, Vorstellungen und Konzepte in den Diskursen ihrer Zeit verhaftet waren oder diese mitprägten bzw. auf sie reagierten. Damit gibt die Ausstellung ebenso Einblick in eine innerjüdische Geschichte wie auch die Hamburger Stadtgeschichte.
Anmerkung zu dem Begriff „Volkskunde“: Wir verwenden den Begriff in der Ausstellung ausschließlich als einen historischen Quellenbegriff der Bestandteil des Vereinsnamens und des von Max Grunwald herausgegebenen Mitteilungsblattes war.
Dies ist der bislang letzte dokumentierte Nachweis über die Existenz der umfangreichen Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde. Als zentrales Dokument steht es der eigentlichen Ausstellung voran und bietet über die markierten Textpassagen direkte Einstiegsmöglichkeiten in einzelne Ausstellungskapitel.
Im 19. Jahrhundert verdoppelte sich die Anzahl der in Hamburg lebenden Jüdinnen und Juden, die gegen Ende des Jahrhunderts etwa vier Prozent der Stadtbevölkerung ausmachten. Vielen gelang ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aufstieg. Die Gründung des reformorientierten Neuen Israelitischen-Tempelvereins 1817 oder der Bau der Neuen Dammtor Synagoge 1894/95 standen für eine Pluralisierung des religiösen Lebens. Aber auch die Grenzen der Akkulturation und Integration wurden immer deutlicher. Vertreter des aufkommenden politischen Antisemitismus machten die Juden zu Verantwortlichen der politischen Krisen und wirtschaftlicher Existenzängste. Die steigende Ein- bzw. Durchwanderung osteuropäischer Juden in Städten wie Hamburg verstärkte judenfeindliche Tendenzen. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft führten diese unterschiedlichen Entwicklungen zu einem neuen Nachdenken über die Bedeutung und Ausgestaltung jüdischer Identität. Die Gründung jüdischer Vereine brachte dies zum Ausdruck und war zugleich Teil des rasanten Verbürgerlichungs- und Wandlungsprozesses der jüdischen Gemeinschaft im 19. Jahrhundert. Als „weltliche For[en] innerjüdischer Diskussion um verschiedene Ansätze der Selbstauffassung“ waren Vereine integraler Bestandteil der bürgerlichen Lebenswelt und boten angesichts zunehmender Ausgrenzung Orientierung, Halt und Sicherheit.
Am 29.10.1903 berichtete das Israelitische Familienblatt von der feierlichen Grundsteinlegung für das Logenheim in der Hartungstraße im Hamburger Grindelviertel, dessen Errichtung von der Henry Jones-Loge initiiert worden war. Die Henry Jones-Loge hatte sich im Jahr 1887 als erste ausschließlich jüdische Loge in Hamburg als regionaler Ableger des jüdischen Ordens B’nei B’rith gegründet. In ihrem Vorstand waren Gustav Tuch und Moses Deutschländer tätig, die zugleich in vielen anderen Vereinen engagiert waren und zentrale Persönlichkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Hamburgs darstellten. Ein knappes Jahr später, im August 1904, drückte der Vorsitzende der Loge Gustav Tuch in seiner Eröffnungsrede seine mit dem Logenheim als Wirkungs- und Begegnungsort verbundenen Wünsche aus: „Wir weihen ein neues Haus, – ein solches der Arbeit und der Geselligkeit. […] Unsere Hoffnungen und Erwartungen gehen dahin, daß die Schaffung einer Stätte, die einer ganzen Anzahl jüdischer Institutionen Aufnahme gewährt, der gemeinsamen Betätigung freiere Bewegung verleihen wird.“ Neben dem Israelitisch-Humanitären Frauenverein, dem Jugendverband, dem Verein für Jüdische Geschichte und Literatur, dem Arbeitsnachweis, der Lesehalle, der Haushaltungsschule, einem Restaurant, Festsälen oder einer Kegelbahn beschloss auch die Gesellschaft für jüdische Volkskunde 1903 die Räumlichkeiten im neuen Logenheim für ihre Bibliothek und Sammlung zu nutzen – so ist es der kurzen Meldung aus dem Israelitischen Familienblatt zu entnehmen.
Neun Jahre nach der Gründung der Henry Jones-Loge in Hamburg im Jahr 1896 initiierte der Hamburger Rabbiner Max Grunwald gemeinsam mit Gustav Tuch und Moses Deutschländer den ersten ethnografischen Fragebogen im jüdischen Kontext. In dem begleitenden Einladungsschreiben wird die Motivation der Initiatoren deutlich, die in der „gewissenhafte[n] Würdigung und womöglich Wiederbelebung des Volkslebens und des Volksgefühls auf Grund sorgsamer Sammlungen zur Volkskunde (Folklore)“ eine Antwort auf die immer schwieriger zu fassende Frage nach einer jüdischen Identität sahen, da „seine [des Volkes] Eigenart der alles ausgleichenden modernen Bildung zum Opfer“ falle. „Die günstige Aufnahme, welche dieses Unternehmen in der Presse sowohl wie an privater Stelle gefunden“ habe, veranlasste wiederum im September 1897 das Comité für jüdische Volkskunde, das sich innerhalb der Henry Jones-Loge (U.O.B.B.) gegründet hatte, zur Gründung einer Gesellschaft für jüdische Volkskunde einzuladen. Ein Schritt, der am 1.1.1898 erfolgte und durch die Veröffentlichung der ersten Ausgabe der von Max Grunwald herausgegebenen Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde öffentlich gemacht wurde. In der darin abgedruckten Satzung wird als Zweck der Gesellschaft benannt, „die Erkenntnis des inneren Lebens der Juden zu fördern“. Dieses Ziel sollte unter anderem durch „eine möglichst vollständige Sammlung aller auf das Judentum und seine Bekenner bezüglichen Volksüberlieferungen und Kunsterzeugnisse“ erreicht werden. Auf den weiteren Seiten werden die bisherigen Eingänge verzeichnet und es findet sich ein Verzeichnis der Mitglieder, das bereits rund 200 Namen umfasst und auf eine weit über den regionalen Kontext hinausweisende Mitgliederschaft verweist, die von Hamburg über Berlin, bis nach Breslau, Budapest oder Straßburg reicht.
Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde konnte nicht nur einen schnellen Mitgliederzuwachs, der weit über Hamburgs Grenzen hinausging, verzeichnen, auch die ersten Sammlungsaufrufe stießen auf große Resonanz, sodass das „Verzeichnis der Sammlungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde“ aus dem Jahr 1900 zahlreiche Objekte, grafische Darstellungen und Handschriften umfasst. Neben dem Sammeln (historischer) Zeugnisse jüdischer Lebenswelten ging es der Gesellschaft auch um das Ausstellen der gesammelten Objekte und so begann schon früh die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Während es in Hamburg an verschiedenen Orten Sonderausstellungen und Vorträge gab, wurden Teile der umfangreichen Sammlung auch in anderen Städten wie etwa in Berlin, Kopenhagen oder bei der Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden gezeigt. Die zwischen 1898 und 1929 von Max Grunwald herausgegebenen Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde gaben Impulse für den Sammlungszuwachs und dokumentierten diesen gleichermaßen. Gleichzeitig rahmten sie das Sammeln durch Beiträge zu volkskundlichen Fragestellungen und ordneten damit die praktische Arbeit in den zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskurs ein. Die Hamburger Initiative gab auch den Impuls für die Gründung einer Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler in Stuttgart und Frankfurt. In Wien konnte ein Museum jüdischer Altertümer und Kunstgegenstände unter der Leitung von Br. Stiasny eingerichtet werden. Auch der Versuch der Gründung eines „Gesamtarchivs der deutschen Juden“, das seit 1903 innerhalb des B’nei B’rith-Ordens in Deutschland vorangetrieben wurde, war Ausdruck der angestrebten „Hebung des jüdischen Bewusstseins und zur Förderung idealer jüdischer Angelegenheiten.“
Sammlungstätigkeit und Veröffentlichungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde waren auf das Dokumentieren und Bewahren jüdischer Alltagskultur ausgerichtet. Dies lässt sich im Kontext mehrerer gleichzeitig stattfindender Entwicklungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verorten, wie der allgemein wachsenden Bedeutung von akademischer Fachwissenschaft, zu der auch der Aufbau von Museen zu zählen ist. Der wissenschaftliche Ansatz war zudem von einer innerjüdischen Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte, Kultur und Identität geprägt, vor dem Hintergrund von jüdischer Emanzipation, dem Streben nach gesellschaftlicher Integration und formaler Gleichstellung sowie der gleichzeitigen Konfrontation mit dem aufkommenden Antisemitismus.
Die „jüdische Volkskunde“ war Teil der Fachdisziplin „Volkskunde“, ein Fach, das im deutschsprachigen Raum aufgrund der Instrumentalisierung durch die NS-Forschung nach 1945 sehr kritisch betrachtet wurde und heute diesen Namen an den meisten Universitäten nicht mehr führt. Inhaltlich richtete die „jüdische Volkskunde“ den Blick auf jüngere jüdische Kultur und Geschichte. Daran geknüpft war – wenn auch nicht immer explizit formuliert – die Frage, was jüdische Identität sei. Die Sammeltätigkeit mit dem Ziel des Bewahrens und Ausstellens bedeutete zugleich eine Musealisierung jüdischer Geschichte und Kultur. Mit dem Ansinnen, ein jüdisches Museum aufzubauen war die Hamburger Gesellschaft Teil einer Welle von Museumsgründungen in Europa, darunter auch erster jüdischer Museen.
Die Objektsammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde umfasste Gegenstände aus dem jüdischen Alltag, darunter zeremonielle Objekte wie Beschneidungsmesser oder von Privatpersonen gestiftete Tora-Wimpel.
Neben dem Sammeln von Zeugnissen jüdischer Lebenswelten ging es den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft auch um das Ausstellen der gesammelten Objekte und Materialien. Bereits in dem 1900 publizierten Verzeichnis der Sammlung ist die Struktur eines Museums für jüdische Volkskunde entworfen, das ausgehend von der „[a]eussere[n] Erscheinung“, die „[g]eschichtliche Ueberlieferung“ und die „[r]eligiöse Eigenart“, das „Familienleben“ sowie das „Verkehrsleben“ thematisieren sollte. In der vierten Ausgabe der Mitteilungen (2/1899) heißt es: „Zur Besichtigung unserer Sammlungen (bei Herrn W. Wolff, Beneckestr. 2) sei hiermit nochmals eingeladen.“ (S. 92) Im Folgejahr konnte der Verwaltung der Sammlung Hamburgischer Altertümer für die Möglichkeit einer Ausstellung in den Räumen des Johanneums am Speersort „herzliche[r] Dank“ ausgesprochen werden. Auch im Gebäude der Patriotischen Gesellschaft war die Sammlung zeitweise ausgestellt. Im November 1905 berichtete Vorstand Paul Rieger über einen Zuwachs von Sammlung und Bibliothek in den Räumen im zweiten Stock des Logenheims. Vier Jahre später stellte eine kurze Notiz in den Mitteilungen Räume im Neubau des Museums für Völkerkunde in Aussicht. Auch in den folgenden Jahrzehnten wurde die Sammlung in Vorträgen und kleinen Ausstellungen im Hamburger Stadtraum präsentiert, wie die kurze Meldung aus dem Israelitischen Familienblatt vom 29.8.1932 verdeutlicht, in der berichtet wird, dass die Jüdische Gemeinde in der Beneckestraße 6 einen Raum bereitstelle, um der Öffentlichkeit die Sammlung zeigen zu können.
Im Februar 1912 vereinbarten der amtierende Vorsitzende der Gesellschaft für jüdische Volkskunde, Dr. Paul Rieger und der Direktor des Museums für Völkerkunde Hamburg, Prof. Georg Thilenius, die Sammlungen der Gesellschaft im Neubau des Museums an der Rothenbaumchaussee als Leihgabe in der neuen Ausstellung zu zeigen. Die Gesellschaft wünschte eine dauerhafte Präsentation und Zugänglichkeit ihrer Sammlungen. Für Georg Thilenius war offenkundig vor allem der ethnografische Bestand von Interesse, der sich in sein vergleichend angelegtes Ausstellungskonzept im eurasiatischen Kontext einzufügen versprach. Im Laufe des Jahres handelten Museum und Gesellschaft einen Vertrag aus, den die Finanzdeputation im Juni 1913 mit der Gesellschaft schloss. Im August 1913 gingen die Sammlungen im Museum ein. Neben der Objektsammlung waren dies auch Buch-, Foto- und Archivbestände, die zwar in den folgenden Jahren im Museum aufbewahrt, nicht aber wie die als von ethnologischem Interesse betrachtete Objektsammlung durch das Museum erfasst wurde.
Wie umfänglich die Sammlung durch die Gesellschaft in der Folgezeit erweitert wurde, ist nicht genau nachzuvollziehen. Für das Jahr 1927 sind zwei Objekte verzeichnet, die der zu diesem Zeitpunkt Vorsitzende Dr. Nathan Max Nathan als Ergänzung an das Museum überwies. Nathan gehörte in den Jahren nach 1913 zu jenen Hamburgerinnen und Hamburgern, die dem Museum auch Judaica für die allgemeine Museumssammlung überließen.
Die Vereinsarbeit wurde nach 1933 beschwerlicher und die Organisation der Mitgliederversammlungen und des Vorstandes gestaltete sich zunehmend schwierig. Im Juni 1934 wählte die Mitgliederversammlung den Wandsbeker Rabbiner Simon Simcha Bamberger zum neuen Vorsitzenden der Gesellschaft für jüdische Volkskunde. In dieser Funktion nahm Bamberger 1937 die noch im Völkerkundemuseum befindlichen Sammlungen des Vereins in seine Obhut. Wo der Verein in der Folge die Sammlungsbestände verwaltet und gelagert hat, ist nicht dokumentiert. Zwischen 1934 und 1936 waren laut Gemeindeprotokollen Räume für die Gesellschaft an verschiedenen Standorten im Gespräch. Im Juli 1937 war sie in zwei Räumen im Gemeindehaus Beneckestraße 6 untergebracht, wo auch Bamberger mittlerweile arbeitete. Von den Bemühungen des Vereinsvorstandes, die Sammlungen weiter auszustellen, zeugen verschiedene Gesuche Bambergers nach Überlassung geeigneter Vitrinen, die im Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 1936 veröffentlicht wurden.
Am 1.2.1938 konnte eine letzte Mitgliederversammlung einberufen werden. Noch im Januar hatte Simon Bamberger dem Amtsgericht Hamburg mitgeteilt, die gesetzten Fristen infolge eines geltenden Versammlungsverbotes nicht einhalten zu können und verwies auf die Unmöglichkeit, überhaupt noch fünf Personen für einen Vorstand zu finden. Neben Bamberger als Vorsitzendem gehörten dem letzten Vorstand Nathan Max Nathan, Alfred Lewald, Max Siegfried Oppenheimer und Arthur Goldstein an.
Mitte der 1930er-Jahre veränderte sich die Situation für die Gesellschaft für jüdische Volkskunde und ihre Sammlungen auch im Museum für Völkerkunde. Dies war politisch bedingt und wurde durch einen Direktionswechsel 1935 verstärkt. Für Gründungsdirektor Georg Thilenius war die Objektsammlung der Gesellschaft von inhaltlichem Interesse und passte in sein Ausstellungskonzept. Der ihm nachfolgende Direktor Prof. Franz Termer war an dieser Thematik wissenschaftlich nicht interessiert und agierte pragmatisch. Die Sammlung der Gesellschaft war unmittelbar davon betroffen. Ein im Oktober 1935 im Kampfblatt der SS, „Das Schwarze Korps“ erschienener Artikel über jüdische Objekte im Museum veranlasste den Dekan der Hamburger Universität, Prof. Adolf Rein, sich an Thilenius zu wenden. Sein Anliegen war offensichtlich eine Entnahme der Objekte. Thilenius hielt in seiner Antwort an der Sammlung als Teil des Ausstellungskonzepts fest, stellte aber zugleich in den Raum, dies bei einer Neugestaltung der gesamten Ausstellung zu überdenken. Adolf Rein scheint in der Folge auf die am 1. November nachfolgende Museumsleitung eingewirkt zu haben und tatsächlich teilte ihm Franz Termer am 19. November mit, er „habe veranlasst, dass die Ausstellung jüdischer Gegenstände aus der öffentlichen Schausammlung des Museums entfernt wird.“
Das kurze Übergabeprotokoll vom 27.4.1937 gibt Auskunft darüber, dass Rabbiner Simcha Bamberger als Vorsitzender der Gesellschaft die noch im Museum verbliebenen Sammlungsbestände abholte. Die Sammlungs- und Objektdokumentation verblieben im Museum.
1938 ist die offizielle Vereinstätigkeit der Gesellschaft für jüdische Volkskunde beim Amtsgericht Hamburg letztmalig dokumentiert. Aus einem Bericht des Gemeindevorstandes Leo Lippmann zur Auflösung Hamburger jüdischer Vereine von 1943 geht hervor, dass die Gesellschaft für jüdische Volkskunde der nationalsozialistischen Gesetzgebung entsprechend 1938 aufgelöst wurde und im Jüdischen Religionsverband Hamburg e.V. aufging. 1953 wurde das Amtsgericht im Zuge einer Überprüfung erneut tätig. Eine Suchanfrage nach den Mitgliedern des letzten Vereinsvorstandes deutet in wenigen Stichworten deren Schicksale nach 1938 an: Dem Vorsitzenden, Rabbiner Simon Simcha Bamberger war im Januar 1939 mit seiner Frau die Emigration nach Palästina gelungen. Auch Max Siegfried Oppenheimer konnte Hamburg verlassen und 1941 nach New York fliehen. Dr. Nathan Max Nathan, langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft und Syndikus der Deutsch-Israelitischen Gemeinde, wurde 1942 mit seiner Frau Dora, geb. Rieger, nach Theresienstadt und von dort 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Alfred Lewald wurde 1940 in Fuhlsbüttel inhaftiert, 1942 ins KZ Dachau deportiert und im Mai 1942 in Auschwitz ermordet. Das Schicksal des fünften Vorstandsmitglieds Arthur Goldstein ist bisher nicht bekannt.
Formal folgte für das Amtsgericht aus diesen Erkenntnissen eine Schließung der Akte. Am 28.10.1959 teilte es per Verfügung mit, die Gesellschaft für jüdische Volkskunde Hamburg e.V. zusammen mit anderen Vereinen aus dem Vereinsregister zu löschen. Eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass die Vorstandsmitglieder entweder ermordet worden waren oder vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, fand in diesem Kontext nicht statt. Die Löschung erfolgte am 30.5.1960.
Die Sammlungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde gehören zu den zahllosen, in der Zeit des Nationalsozialismus bzw. unter deutscher Besatzung als verschollen oder zerstört geltenden Kulturgütern aus jüdischen Gemeinden, Bibliotheken, Museen und anderen jüdischen Einrichtungen. So führte bereits die „Tentative List of Jewish Cultural Treasures in Axis-Occupied Countries” aus dem Jahr 1946 die Sammlungen auf. Die erste Liste wurde unter Leitung von Hannah Arendt im Auftrag der prominent besetzten Commission on European Jewish Cultural Reconstruction in New York erstellt und als Beilage in der Zeitschrift „Jewish Social Studies“ (8,1) veröffentlicht.
Als Hannah Arendt 1949 in ihrer Funktion als Emissärin der 1947 in New York gegründeten Treuhandgesellschaft Jewish Cultural Reconstruction, Inc. (JCR) nach Deutschland reiste, besuchte sie auch Hamburg, um sich dort einen Überblick über noch vorhandene und restituierbare jüdische Kulturgüter zu verschaffen. Ihr während des Besuches verfasster Bericht zeigte, „dass sich die Situation in der britischen Zone, und besonders in Hamburg, von der der amerikanischen in Bezug auf Gemeindestruktur und vorgefundene[] Kulturgutsammlungen deutlich unterschied. Fanden sich in der amerikanischen Zone zahlreiche Raubbestände aus ganz Europa, hatte sich insbesondere die Stadt Hamburg während des Nationalsozialismus dadurch hervorgetan, konfiszierte Objekte aus Eigeninteresse in Hamburg zu behalten und nicht etwa nach Berlin zu übergeben, was nach dem Krieg dazu führte, dass Sammlungen wenigstens teilweise auffindbar waren und (wenn auch zögerlich) rückerstattet wurden.“ In ihrem Bericht erwähnt Arendt auch einen Besuch bei dem Kustoden Dr. Kunz Dittmer im Hamburger Völkerkundemuseum, bei dem sie erfolglos versucht habe, etwas über die Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde herauszufinden.
Im Herbst 1963 zeigte die Stadt Köln die erste große Ausstellung zur jüdischen Geschichte in der Nachkriegszeit, die Monumenta Judaica. In zwei Museumshäusern wurden über 2.000 international entliehene Objekte in einem breiten zeitlichen und inhaltlichen Themenspektrum präsentiert. Die Ausstellung wurde mit einem gleichnamigen dreibändigen Katalog dokumentiert. Auslöser für die Ausstellungsplanung waren Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge im Dezember 1959 und antisemitische Nachahmungstaten in der ganzen Bundesrepublik. Mit einer großen Ausstellung über jüdische Geschichte im Rheinland sollte diesen antisemitischen Übergriffen etwas entgegengesetzt werden.
Auch das Altonaer Museum war mit Leihgaben an der Monumenta Judaica beteiligt. Dass sich unter diesen auch Objekte aus der Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde befanden, war zum damaligen Zeitpunkt offensichtlich niemandem bewusst. Die sehr allgemein gehaltenen Herkunftsangaben wichen von den ursprünglichen, in der Dokumentation der Gesellschaft enthaltenen Angaben, ab.
Die Ausstellung fand auch internationale Resonanz und war ein Auslöser für die Neugründung des ersten jüdischen Museums im deutschsprachigen Raum nach 1945, dem Jüdischen Museum der Schweiz in Basel im Jahr 1966.
Im November 1991 eröffnete das Museum für Hamburgische Geschichte eine erste umfassende Ausstellung über „400 Jahre Juden in Hamburg“ nach einem Konzept des Hamburger Historikers Ulrich Bauche. Die vorausgehenden Recherchen erfolgten in enger Kooperation mit dem Verein ehemaliger jüdischer Mitbürger Hamburgs in Jerusalem um den Judaica-Spezialisten Naftali Bar-Giora Bamberger. Eine mehrbändige Publikation mit Katalog und wissenschaftlichen Artikeln begleitete die Ausstellung. Das breite Begleitprogramm mit Podiumsdiskussionen, Synagogenführungen und kulturellen Veranstaltungen wurde von der Jüdischen Gemeinde in Hamburg mitgetragen.
Die vorbereitenden Arbeiten umfassten auch eine Bestandsaufnahme der in den öffentlichen Sammlungen befindlichen Judaica. Sie wurden mit Unterstützung Naftali Bar-Giora Bambergers bestimmt und zugeordnet. Das in diesem Kontext bekannteste wieder entdeckte Objekt war ein achtarmiger Chanukkaleuchter, der auch Ausstellungsmotiv wurde. Im 17. Jahrhundert gestiftet, hatte er sich bis zur Pogromnacht 1938 in der Altonaer Synagoge Kleine Papagoyenstraße befunden. Danach gelangten Fuß und Kandelaberhalterung in das Altonaer Museum. 1991 anhand der Inschriften identifiziert, befindet sich heute eine Reproduktion dieses Leuchters in der Synagoge Hohe Weide.
Ebenfalls im Depot des Altonaer Museums stießen Naftali Bamberger und der Ausstellungskurator Ulrich Bauche auf die neun heute im MARKK befindlichen Objekte aus der Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde. Anhand der Objektnummern und der im damaligen Völkerkundemuseum erhaltenen Dokumentation konnte die Projektmitarbeiterin Heide Lienert-Emmerlich sie als Teil der Sammlung identifizieren. Die Geschichte der Gesellschaft für jüdische Volkskunde, ihrer Sammlungen und der erhalten gebliebenen Objekte wurde erstmals wieder öffentlich.
Die Geschichte der Sammlungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde im ehemaligen Museum für Völkerkunde ist dort im Museumsarchiv dokumentiert. Erhalten sind die formalen Korrespondenzen zwischen den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft, der Direktion und den Mitarbeitern des Museums sowie die Vereinbarung von 1913, mit der die räumliche Unterbringung der umfänglichen Sammlungsbestände im Museum schriftlich festgehalten wurde. Eine Reihe von Anfragen, Einsichtnahmen und Teilrückgaben, unter anderem von Buchbeständen und einer Medaillensammlung aus den folgenden Jahren verweisen auf die Entwicklung und Nutzung der Sammlung durch die Gesellschaft und ihre Mitglieder. Auf Museumsseite erfolgte eine Erfassung der Objektsammlung in Bild und Schrift. So verwahrt das Museum eine fotografische Dokumentation und Basisbeschreibungen zu den mehr als 200 Objekten und einem großen Teil der Medaillen und Münzen. Nach 1913 wurden die Bestände zunächst mit temporären Nummern verwaltet, 1929 dann mit Inventarnummern im gängigen Museumssystem versehen, ohne jedoch ihren Status als Leihgabe zu verlieren.
Heute sind diese Sammlungsdokumentationen die wohl einzig verbliebenen Zeugnisse der weitgehend als verschollen geltenden Sammlung. Sie bilden die Grundlage für fortgesetzte Recherchen zu ihrem Verbleib in den kommenden Jahren.
Im Juni 2021 startete im MARKK neben der Provenienzforschung in kolonialen Kontexten auch ein erstes Projekt zur Überprüfung der Bestände auf NS-Raubgut, gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Untersucht wird dabei die Erwerbsgeschichte der Objekte im Hinblick auf unrechtmäßige Besitzwechsel oder Aneignungskontexte in der Zeit des Nationalsozialismus. Am Anfang stand die Überprüfung der europäischen Judaica. Einige Objekte und die Dokumentation zur Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde waren bekannt, das Wissen um die 1991 aus dem Altonaer Museum ans MARKK überwiesenen Objekte aus der Sammlung der Gesellschaft für jüdische Volkskunde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr vorhanden.
Die in vielen Aspekten bereits bekannte Sammlungsgeschichte wird im Rahmen der Provenienzforschung neu rekonstruiert: Nachgewiesen sind Erwerbungen der Gesellschaft in den ersten Jahren ihrer Sammlungstätigkeit und die Leihgabe an das damalige Museum für Völkerkunde (heute MARKK). Die für 1937 dokumentierte Rückgabe der Sammlungen an den Vereinsvorsitzenden Simon Simcha Bamberger enthält keine detaillierten Auflistungen der einzelnen Gegenstände. Auch ist nicht bekannt, wann, wie und durch wen die heute im MARKK befindlichen Objekte zuvor in das Altonaer Museum gelangt waren. Für die Objekte besteht somit noch eine wichtige sogenannte Provenienzlücke, Eigentumsfrage und Verbleib lassen sich daher bislang nicht eindeutig klären. Ein wichtiger erster Schritt, der mit dem Provenienzprojekt angestoßen wurde, ist, Transparenz herzustellen und die Bestände und ihre Geschichte wieder bekanntzumachen, etwa durch diese Ausstellung oder die Dokumentation in der Lost Art-Datenbank der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.
Die Provenienzforschung am MARKK wurde gefördert von: Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.
Die abgebildeten Holztafeln sind in den Sammlungslisten der Gesellschaft für jüdische Volkskunde leicht zu identifizieren und 1903 als Zugang aus der Synagogengemeinde Graetz bei Posen in Bd. 12 der Mitteilungen verzeichnet. Übereignet wurden sie durch Herrn J. Rosenberg, ebenfalls aus Graetz stammend. Zu diesem Namen liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Die synagogale Herkunft ist naheliegend, die hebräischen Inschriften „tal u-matar“ („Tau und Regen“) und „maschiw ha-ruach“ („Du lässt den Wind wehen“) verweisen auf jahreszeitlich gebundene Einschübe in das Schmone Esre (Achtzehnbitten-Gebet), dem Hauptgebet im jüdischen Gottesdienst. Die Form der beiden Tafeln, deren Umrandung mit sogenannter Rocaille verziert sind, lässt auf eine Datierung im 18. Jahrhundert bzw. um 1900 schließen. Möglicherweise stand die Abgabe an die Gesellschaft für jüdische Volkskunde im Zusammenhang mit der Auflösung eines alten Synagogenbaus aus dem 18. Jahrhundert.
Der Großteil der im Museum befindlichen Gegenstände wurde im museumseigenen Karteikartensystem verzeichnet und erhielt 1929 eine ebenfalls museumseigene Inventarnummer. Aus dieser Zeit stammen auch die historischen fotografischen Abbildungen.
Das abgebildete Spitzglas mit einer eingravierten Inschrift ist als eines von zwei Gläsern 1903 in Bd. 12 der Mitteilungen unter den Sammlungseingängen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde verzeichnet. Die hebräische Inschrift, die in der Übersetzung „Tsebi, Landrabb. von Hildesheim“ lautet, ermöglicht eine Identifizierung. Das zweite Glas ist nicht vorhanden und wird im MARKK als 1937 an die Gesellschaft zurückgegeben geführt. Entstehungszeit und genaue Herkunft beider Gläser sind nicht bekannt. Widmungsgläser dieser Art waren jedoch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beliebt. Die Widmung deutet auf Hildesheim und Umgebung hin, unter den dort im 19. Jahrhundert tätigen Landesrabbinern konnte bisher der Name Tsebi oder Zwi / Zvi jedoch nicht zugeordnet werden.
Spender beider Gläser an die Gesellschaft war 1903 Samuel Leibowitz (1850-1932) aus Hamburg, der bis 1916 als Ökonom im Altenhaus der Deutsch-Israelitischen Gemeinde (Sedanstraße 23) tätig war und in den Mitteilungen als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft sowie ab 1917 als ihr Schatzmeister geführt wird.
Das Museum am Rothenbaum (MARKK) setzt sich seit mehreren Jahren aktiv mit der Geschichte des Museums und der dort bewahrten Sammlungsbestände auseinander. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Erwerbsumständen. Dabei geht es jedoch nicht um eine isolierte Rekonstruktion der Besitzwechsel selbst. Geschichte und Bestand des Museums als öffentliche Einrichtung in Hamburg sind durch städtische und Handels-Netzwerke geprägt und somit eng mit der Geschichte der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner verbunden.
Die kritische Überprüfung von Erwerb und Aneignung von Sammlungsbeständen auf mögliche Unrechtskontexte erfordert eine gesonderte Forschung, die das MARKK in Provenienzforschungsprojekten zu kolonialen Kontexten und NS-Raubgut durchführt. Für diese Forschungen gelten bestimmte Rahmenbedingungen: Grundlage der Provenienzforschung zu NS-Raubgut sind in Deutschland die 1998 international verabschiedeten Washingtoner Prinzipien und die 1999 verfasste Gemeinsame Erklärung. Mit beiden Erklärungen hat sich Deutschland verpflichtet, öffentliche Einrichtungen zu einer Überprüfung ihrer Bestände auf NS-Raubgut anzuhalten und diese zu ermöglichen. Ungeachtet des Ablaufs juristischer Fristen ist das erklärte Ziel, mit den rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern eine „gerechte und faire Lösung“ zu finden.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg bündelt die Aktivitäten in diesem Bereich und ist zentraler Ansprechpartner für unrechtmäßig entzogenes Kulturgut. Darüber hinaus fördert es Provenienzprojekte, so auch im MARKK. Die vom Zentrum betreute Lost Art-Datenbank dient der Dokumentation von und Suche nach kritischen Beständen im zeitlichen Kontext des Nationalsozialismus, insbesondere NS-Raubgut.
Auch das MARKK speist dort seine Ergebnisse ein. Diese Online-Ausstellung ist eine weitere Möglichkeit, Forschung und Ergebnisse öffentlich zu machen und so dem Selbstanspruch eines transparenten Museums gerecht zu werden.
Die nur noch fragmentarisch erhaltene Sammlung steht stellvertretend für die Vernichtung und Zerstörung jüdischen Lebens und Kulturgutes, die ausstehende Rekonstruktion dieser Sammlungsgeschichte zeigt die (Wissens-)Lücken, die bis heute bestehen. Ursprünglich wurden die Objekte als volkskundliche Quellen gesammelt und ihre religiöse Funktion bzw. ihr identitätsstiftender Gebrauch standen im Fokus. Heute sind sie zu Platzhaltern für das nicht mehr Existierende geworden, ihre Bedeutung ist zudem symbolischer Natur, indem sie auf ein „jüdisches Erbe“ verweisen, weitgehend losgelöst von ihrer ursprünglichen Funktion und Geschichte. Die Objektforschung ist heute daher umso mehr gefordert, die individuellen Objektbiografien möglichst umfassend zu rekonstruieren, um den zahlreichen Bedeutungsebenen der Objekte gerecht zu werden. Denn werden die Objekte und ihre Überlieferungsgeschichte ernstgenommen, dann stehen sie nicht nur für eine volkskundlich motivierte Sammlungstätigkeit und damit für das wissenschaftliche wie kulturelle Engagement einiger herausragender Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie stehen auch für bürgerliches Vereinsleben, Säkularisierung, für Netzwerke, die über die jüdische Gemeinschaft ebenso wie über Stadtgrenzen hinausreichten, sie stehen für Fragen nach Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft, aber eben auch für die Herausdrängung aus eben dieser und die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Akteure. Schließlich steht die Sammlung für Fragen nach dem Umgang mit der historischen Verantwortung und dem nicht zerstörten jüdischen Kulturerbe durch die städtischen Akteure und Institutionen. Ein Kontext, in dem sich auch die Forschungs- und Ausstellungsarbeit am MARKK verorten lässt.
Konzeption und Texte: Jana Caroline Reimer
(MARKK) und Dr. Anna Menny (IGdJ). Technische Umsetzung: Helena Geibel (IGdJ).
Eine Kooperation zwischen dem IGdJ und dem MARKK - Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt im Rahmen der
Provenienzforschung zu NS-Raubgut.
Stand: 14.2.2025.